
Am Sonntag, dem 9. März 2008 um 17.05 Uhr habe ich auf diesen Seiten den ersten Beitrag von eGomera – Insel im Netz gepostet, am Montag, dem 30. Dezember 2019 um 19.26 Uhr den letzten. Dazwischen lagen die aufregenden Jahre eines freundlichen und informativen Forums.

Gegeründet wurde eGomera, nachdem das damals größte und netteste deutschsprachige Forum für die Insel – blondies gomercafé – technisch und administrativ an seine Grenzen stieß.
Es war von seiner Betreiberin nie als umfassende Informationsplattform gedacht und diente von seiner Konzeption her eher dem vergnüglichen Austausch, als dem Ansammeln und Weitergeben von Inselnachrichten und Hilfreichem für Besucher La Gomeras.
Das war la rana, vida llena und mir nicht genug. So haben wir nach recht kurzer Vorbereitungsphase zur technischen und organisatorischen Umsetzung mit der Insel im Netz ein Forum aus der Taufe gehoben, das mit seinen über 50 Unterforen oder Kategorien von vorneherein umfassender und informativer angelegt war, als alle bis dahin existierenden Forenportale zu La Gomera.
Zusammen mit uns dreien waren nemo, kiwi, herbi, Lee und juanita Mitglieder der ersten Stunde und gemeinsam mit einer schnell wachsenden Gemeinschaft von Nutzern haben wir den Mut und den Elan des Neuanfangs genutzt und über viele Jahre hinweg mit Freude und Menschlichkeit eine Seite aufgebaut, die ein Anlaufpunkt für viele Freunde La Gomeras geworden ist und von vielen Reisenden als Informationsquelle genutzt wurde.
Neben aktuellen Informationen wie Fahrplänen für Busse und Fähren, Veranstaltungen, wichtigen Telefonnummern, Empfehlungen für Wanderwege, Tipps zu Standortwahl und Reisegepäck wurde eGomera mit über 25.000 Bildern zu einem der größten öffentlichen Fotoarchive für La Gomera im Internet.
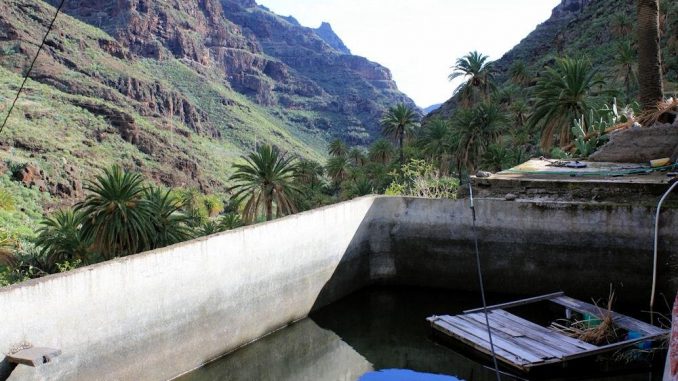
Wer gerade vorort war, allen voran La rana, steuerte aktuelle Nachrichten bei. So haben wir zum Beispiel bei dem großen Feuer in Valle Gran Rey quasi live berichtet.
Wir haben uns über die Pflanzen- und Tierwelt La Gomeras genauso ausgetauscht, wie über Geschichte und Legenden der Insel, die spanische und speziell die kanarische Sprache, Kunst und Kultur, Wirtschaft und Politik und vieles vieles mehr.
Mit Spielen wie dem Gomeraquiz und den großen Adventsrätseln haben wir uns so manche Stunde lang die Zeit vertrieben.
Aktuell hat eGomera 251.914 Beiträge in 35.978 Themen, die von 2.028 registrierten Benutzern erstellt wurden.
Mit den Jahren haben Schwung und Enthusiasmus nachgelassen und einer breiten Routine Platz gemacht. Wir haben uns darauf konzentriert, die Software auf dem neuesten Stand zu halten und neue, freundliche Features zu programmieren.
Alles lief in die richtige Richtung: freundlich, offen, informativ, unterhaltsam.
Langsam aber schlich sich ein anderer Ton ein, wie an vielen Stellen im Netz. Zunächst machte sich uns das durch den vermehrten Moderationsaufwand bemerkbar. Dieser stieg anfangs mählich, später stark an.
Gleichzeitig änderten sich im Laufe der Jahre unsere Interessen und Ziele, die Wege änderten, lange unbemerkt, ihre Richtung und liefen mehr und mehr auseinander.
Zu allem Überfluss ist es uns nicht gelungen, eine dauerhafte, ausreichende interne Kommunikation zu etablieren.
Diese Mischung aus mangelnder Sicht und auseinanderstrebender Tendenzen führte schließlich zum Zerfall des Bundes.
Deutlich spürbar wuchsen die Spannungen in der Gemeinschaft und der Wille, in der öffentlichen Diskussion als Korrektiv zu wirken, wurde immer kleiner.
Der Moderationsbedarf wuchs sehr stark.
Aus meiner Sicht fehlte zunehmend eine gemeinsame Richtung, das Forum zerfaserte.

Schließlich wurde die Urheberrechtsreform samt (dem damaligen) §13 von der EU beschlossen, die Betreiber von Internetseiten haftbar für Inhalte macht, die von ihren Nutzern hochgeladen werden und sie zwingt Rechte für diese Inhalte zu erwerben.
All dies zusammen hat uns bewogen, nach langem Abwägen und Ausloten von Möglichkeiten, eGomera als Forum zu schließen. So traurig uns das macht, es ist besser für alle, als darauf zu warten, dass es langsam im Kleinklein von Missgunst und Ignoranz untergeht.
Nun ist das Schließen eines Forums eine Sache, das Löschen aller Informationen eine andere.
Zusammen mit vielen Nutzern von eGomera sind wir der Meinung, dass das angesammelte Inselwissen für die Allgemeinheit erhalten bleiben sollte.
Wir haben also beschlossen, eGomera zu konservieren. Weiterhin unter dem Namen eGomera – Insel im Netz und weiterhin unter der Internetadresse egomera.de, doch insgesamt als Unterkategorie von Spanien im Netz.
Dabei überführen wir die Originalbeiträge mit dem Original-Look&Feel in die Software von Spanien im Netz und behalten die ursprüngliche Struktur der Unterforen weitestgehend bei.
Allerdings werden wir nicht alle Beiträge überführen. So werden wir die Themen, die vorher nicht im öffentlichen Bereich zu finden waren, auch hier nicht veröffentlichen. Beiträge, bei denen ggf. das Urheberrecht verletzt wird, bleiben in der Versenkung. Darüberhinaus werden wir nur solche Themen und Beiträge übernehmen, deren Informationen von allgemeinem Interesse sind oder die für das Wesen eGomeras typisch sind.
Persönliche Daten wie z.B. Emailadressen veröffentlichen wir nicht. Wer Kontakt zu einem ehemaligen Nutzer eGomeras sucht, schreibt an info@egomera.de. Ich leite die Anfrage wenn möglich weiter.
Avatarbilder, sofern sie Gesichter von Nutzern zeigen, entfernen wir vor Veröffentlichung, es sei denn, der/die Nutzer*in wünscht audrücklich, dass das Bildchen bei seinen/ihren Beiträgen bleibt (info@egomera.de).
Damit wartet viel Arbeit auf uns und so wird sich eGomera noch einmal über einen langen Zeitraum füllen, diesmal als Museum.
Bis dahin grüßt Euch noch einmal
Euer alter eGo


Hinterlasse jetzt einen Kommentar